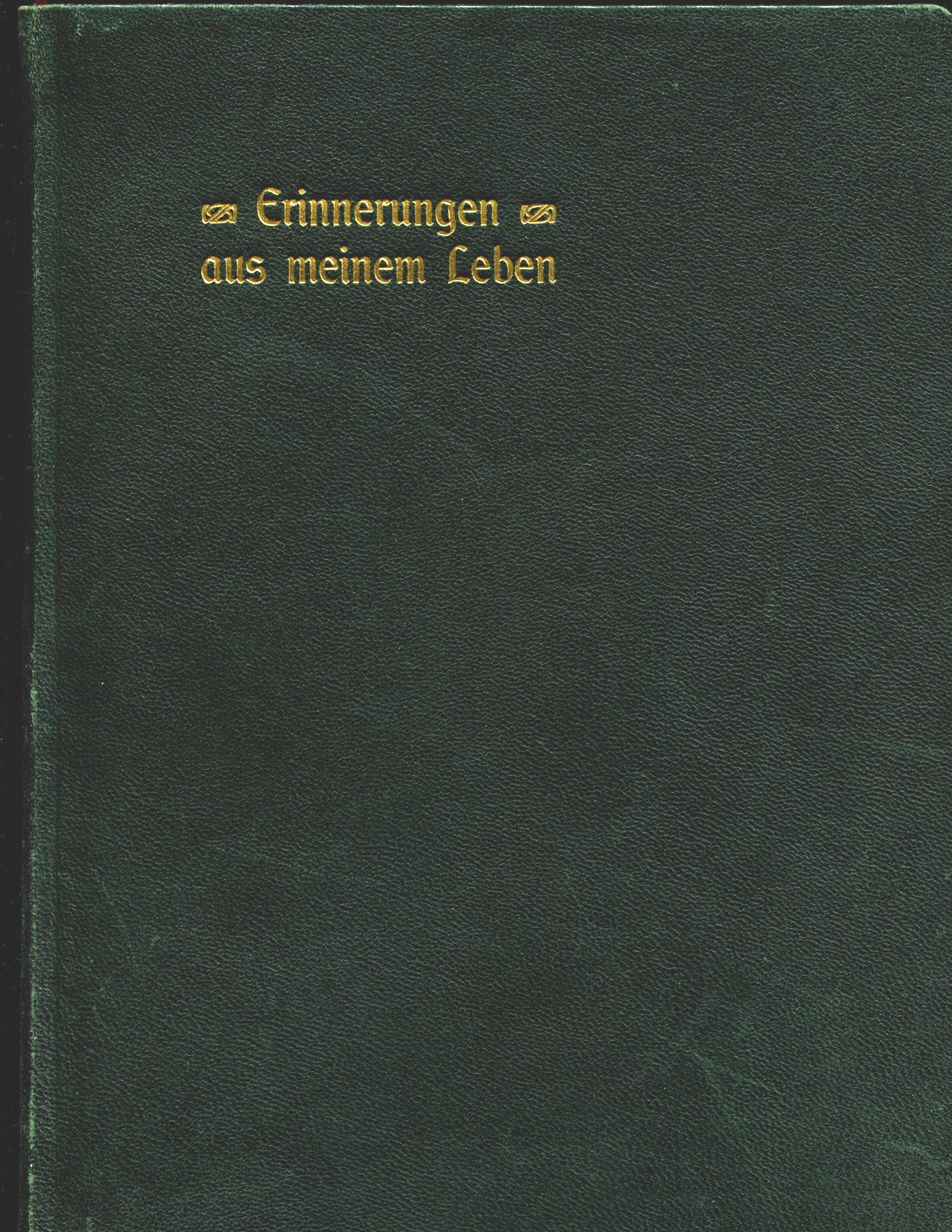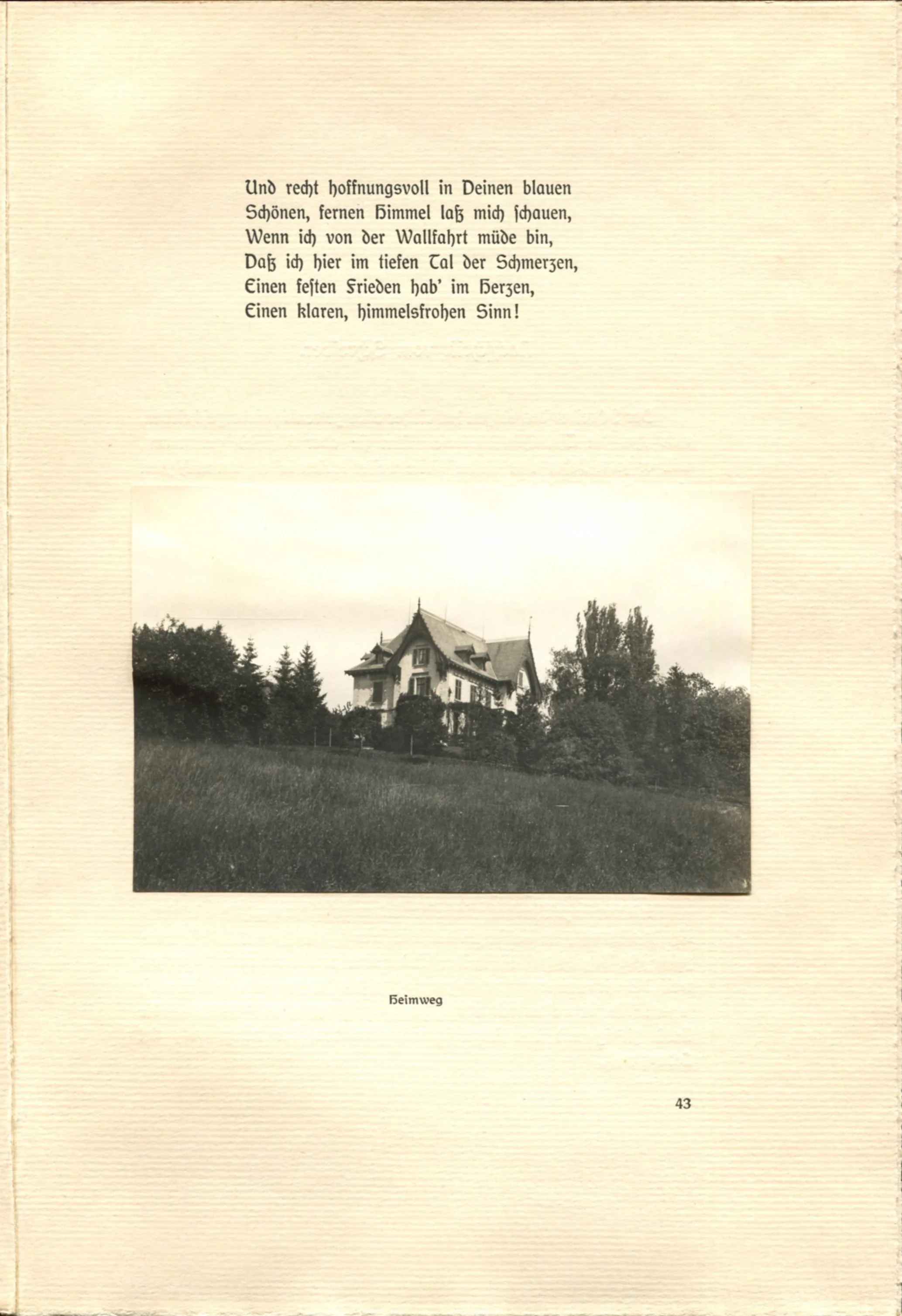Im Jahr 1909 schrieb Dietrich Schindler-Huber, der Neffe von Pauline Escher, ihre Erinnerungen nieder und liess ein Buch drucken . Anlass war der 80. Geburtstag von “Tante P”, wie sie auch von der nachkommenden Generation, ja sogar noch von meinem Vater (*1935) genannt wurde. Hier der vollständige Inhalt des Buches.

Wollenhof
Mein Geburtstag ist der 26. September 1829. Dieser Tag
trägt im Bürklikalender den Namen Pauline. Damit hat
es seine besondere Bewandtnis. Vorher stand dort ein
anderer Name. Aber Herr Bürkli und mein Vater waren
gute Bekannte und als der Kalendermann von meiner Geburt hörte,
wollte er meinem Vater eine Freude machen und teilte ihm mit, dass
in Zukunft der Geburtstag den Namen des Kindleins tragen werde. So
kommt es, dass seither am 26. September Pauline im Zürcher
Kalender steht. Meine Geburtsstätte ist der Wollenhof, jenes alte
Gebäude an der Limmat, das schon im 10. Jahrhundert eine
kaiserliche Zollstätte gewesen sein soll samt Kaufhaus für alle Waren,
die von Wallenstadt an zu Wasser nach Basel und weiter rheinabwärts
gingen. Später war es als „Sidemülli“ bekannt, um im 17. Jahrhundert
den bis ins Jahr 1878 getragenen Namen „Wullenhof“ anzunehmen.


Meine Großeltern väterlicherseits waren Herr Salomon Escher, Zunft-
meister, wohnhaft gewesen im Wollenhof und seine dritte Frau Regula
Bodmer, Schwester von Bodmer im Windegg und Heinrich Bodmer in
der Arch. Großvater und Großmutter kannte ich nicht; die Großmutter
starb, als mein Vater 3 oder 4 Jahre alt war, der Großvater 8 Jahre später.
Man erzählte sich in meiner Jugend, dass die Großmutter ihre Heirat
habe verschieben müssen, bis ihr jüngster Bruder, Heinrich Bodmer in
der Arch, zur Welt gekommen sei, weil sie ihre Mutter dann pflegen musste.
Mein Großvater war eher ein etwas pedantischer Mann und im Gegen-
satz zu seinem Schwager, Junker Georg Escher von Berg, ein sehr solider
Charakter. Junker Escher war ein Aristokrat, diese hielten zu Österreich,
während mein Großvater als „Patriot“ mit den Franzosen ging. Als
dann Junker Escher wegen politischen Umtrieben sich nach Stuttgart flüchten
musste, besorgte mein Großvater seine Familien- und Gutssachen in Berg
und Eigenthal.
Meine Großeltern mütterlicherseits waren Herr Gerichtsherr Paulus
Heß im Florhof und seine Frau geborene Küngold Schultheß aus dem
Schmittenhaus. Herr Paulus Heß war Gerichtsherr in Nürenstorf, be-
kannt als ein gerechter Richter, der die Weiber in die Trülle stecken
lassen musste; er verschaffte sich Respekt und verstand es mit den Leuten
umzugehen. Dazumal bestanden noch die Malefiz-Gerichte als oberste,
über Leben und Tod entscheidende Gerichtsbehörde. Es wurde uns Kindern
erzählt, wie es da hergegangen. War es ein Todesurteil, welches das Gericht
gefällt hatte, so wurde dasselbe am Mittwoch Nachmittag durch die
Geistlichen dem Delinquenten angekündigt, am Donnerstag Nachmittag
1 Uhr wurde derselbe von den Geistlichen, Weibeln und Landjägern im
Wellenberg abgeholt, und unter fortwährendem Geläute vor das Rathaus
geführt, wo er unterhalb der Treppe das Urteil anhörte, welches von
einem Sekretär aus einem der Fenster des Großratssaales verlesen wurde.

Meine Großeltern mütterlicherseits waren Herr Gerichtsherr Paulus
Heß im Florhof und seine Frau geborene Küngold Schultheß aus dem
Schmittenhaus. Herr Paulus Heß war Gerichtsherr in Nürenstorf, be-
kannt als ein gerechter Richter, der die Weiber in die Trülle stecken
lassen muszte; er verschaffte sich Respekt und verstand es mit den Leuten
umzugehen. Dazumal bestanden noch die Malefiz-Gerichte als oberste,
über Leben und Tod entscheidende Gerichtsbehörde. Es wurde uns Kindern
erzählt, wie es da hergegangen. War es ein Todesurteil, welches das Gericht
gefällt hatte, so wurde dasselbe am Mittwoch Nachmittag durch die
Geistlichen dem Delinquenten angekündigt, am Donnerstag Nachmittag
1 Uhr wurde derselbe von den Geistlichen, Weibeln und Landjägern im
Wellenberg abgeholt, und unter fortwährendem Geläute vor das Rathaus
geführt, wo er unterhalb der Treppe das Urteil anhörte, welches von
einem Sekretär aus einem der Fenster des Großratssaales verlesen wurde.
Hierauf wurde der Delinquent von dem Scharfrichter gebunden und,
begleitet von den zwei Geistlichen, über die untere Brücke, die Strehl-
gasse hinauf durch den Rennweg, längs der Sihl und zur Sihlporte
hinaus auf die Richtstätte geführt und dort das Strafurteil vollzogen.
Herr Paulus Heß betrieb neben seiner Tätigkeit als Gerichtsherr
einen Rohseidenhandel; mit seinen Mailänder Seidenherren tauschte er
kleine Aufmerksamkeiten aus: er sandte Zürcher Zungen nach Mailand,
sie Zuckererbsen, Kastanien, große Brote und flüssige Nouga nach Zürich.
Im Sommer wohnte mein Großvater abwechselnd im Letten und in
Nürenstorf. Der Letten gehörte ihm; er war ein guter Landwirt.

Politisch hielt er es wie sein Schwager, Burgermeister Paul Usteri, mit
den „Patrioten“. Ums Jahr 1843 ließ er sich seinen Zopf mit der
kleinen Masche — der bis dahin von fast allen Herren getragen wurde
— abschneiden und schenkte ihn seiner ältesten Enkelin; er ist heute
noch in der Familie.
Die Großmutter war eine lebhafte, äußerst angenehme Frau.
Meine Mutter war eine schöne Frau; ich sehe sie heute noch im
Sammetrock mit Spitzen und Strauszenfedern im Haar. Sie erzählte
oft, wie sie als Kind mit ihrer Mutter, den Geschwistern und der
Stubenmagd um einen Tisch saßen, auf dem ein Unschlittlicht
brannte. Sie erinnerte sich auch gerne einer Soirée bei Madame
Schultheß zum Rech, wo sich die fremden Diplomaten trafen, und wo
bei jenem Anlaß — es war ein Bal costumé — der französische
Gesandte Talleyrand als Marchande de coeurs verkleidet, ihr ein
goldenes Herz schenkte, das noch vorhanden ist. In jener Soirée
erhielt Talleyrand die Mitteilung, daß Napoleon von der Insel Elba
kommend, am 1. März (1815) in Marseille gelandet sei; dieser Umstand
erklärte später den Anwesenden das plötzliche Verschwinden
Talleyrands aus der Soirée.
Von ihrer Hochzeitsreise wußte sie zu erzählen, daß, als sie in der
Stuttgarter Oper war, mit einem rosaroten Hut, der König von
Württemberg einen Lakeien sandte um sich zu erkundigen, wer die
hübsche jungeDame sei. Dagegen beklagte sie sich, daß sie mit ihrem
jungen Gatten immer so laut sprechen müsse, weil er nicht gut höre.
Mein Vater hatte seine Eltern, wie bereits erzählt, frühzeitig ver-
loren. Er machte seine Lehre im Geschäft des Herrn Direktor Daniel
Bodmer an der Sihl und besuchte später mit Herrn Bodmer die Frank-
furter Messe. Wir wissen wenig über seine Jugendjahre; oft hat er von
seiner Stiefgroßmutter gesprochen, einer geborenen Steiner von
Winterthur, Mutter der zweiten Frau seines Vaters, die im
Brunnenturm wohnte und sich seiner sehr annahm. Diese Frau Escher
von Berg war in der ganzen Stadt bekannt für ihre vorzüglichen
Reisküchli, die niemand so wie sie zu machen verstand.
Im Jahre 1816 heiratete mein Vater. 1822 kaufte er das Landgut
zum Engenweg von Baumeister Voegeli „nebst Vieh, Schiff und
Geschirr“, wie ein Eintrag unterm 31. August jenes Jahres im Gutbuch
des Engenweg erklärt.

Pauline
Wenn ich von mir selber erzählen soll, so ist eine meiner frühesten
Erinnerungen der Tag, an welchem ich an der Hand meines Vaters
in ein dunkles Zimmer geführt wurde, in dem ein grün umhangenes
Wiegeli stand und in welchem man mir mein neugeborenes
Schwesterchen zeigte (17. Februar 1833). Eine weitere ganz deutliche
Erinnerung ist die, dass ich mit meinem Papa bei einbrechender
Dunkelheit vom Engenweg in die Stadt wanderte und dann das
schaurige Schauspiel hatte, dass bei der Schmiede außerhalb der Porte
glühende Funken aus dem Kamin flogen. Die Schmiede mit den
Schurzfellen und Ambossen und Hämmern machten jedesmal einen
gewaltigen Eindruck auf mich.


Zum besseren Verständnis muss ich hier eine kurze Beschreibung des
damaligen Zürich geben, wie ich es noch in der Erinnerung habe. Die Nieder-
dorfporte bestand damals noch (bis 1835), und die Neumühle war in die
Fortifikationsmauern zum Teil eingebaut. Den Übergang über die Limmat
vermittelte hier der sogenannte lange Steg, eine hölzerne, offene Brücke für
Fußgänger; er verband den untersten Teil der großen Stadt mit dem
Schützenplatz. Weiter oben, am Fröschengraben war das Rennwegtor
und am Zürichsee, beim Ausflusse der Limmat aus dem See, stand noch
das feste Pallisadenwerk mit einer verschließbaren Öffnung zum Durch-
lassen für die Schiffe. Die Einfahrtsstelle war gesperrt durch einen mit
Eisenspitzen beschlagenen Stamm, den sogenannten Grendel und außerdem
noch besonders geschützt durch einen darüber errichteten steinernen Bau,
die Grendelhütte. Dahinter stand mitten im Flusse ein fester Turm, der
Wellenberg, welcher als Gefängnis benützt wurde. Um die ganze Stadt
herum liefen noch die Schanzen, doch waren die Porten, das Oberdorf-
tor, das Kronentor und das Niederdorftor bereits abgetragen und die
Entfernung der Schanzen war (seit 1833) auch beschlossene Sache. Trotz-
dem war der Eintritt in die Stadt bei Nacht nicht möglich; aus polizeilichen
Gründen wurden die Tore verrammelt und die Schlüssel auf der Haupt-
wache beim Rathaus deponiert. Dort mussten sie vom Pförtner erst
geholt werden, wenn sich der Einlass-Begehrende über seine Persönlichkeit
ausgewiesen hatte.
Eine Erinnerung aus frühester Jugend ist auch die erste Fahrt eines
Dampfschiffes auf dem Zürichsee. Es muss etwas ganz außerordentliches
gewesen sein, dass es mir als ein so wichtiges Ereignis im Gedächtnis
blieb. Was ich erzähle, ist mir geblieben von Beschreibungen, die mir
damals gemacht wurden. Darnach soll das Schiff im Jahre 1835.
von England gekommen und von Mannheim aus mit feinen eigenen
Maschinen nach Kaiser-Augst gefahren sein. Dort sei es auseinander-
genommen und in Zürich wieder montiert worden. Als „Minerva“
habe es dann regelmäßig Fahrten nach Rapperswil unternommen. 1838
kam das zweite Dampfschiff auf den See, das von Escher-Wyß gebaut
wurde und den Namen „Republikaner“ trug. 1839 wurde sodann
der „Linthescher“ auf den Zürichsee versetzt; ein Jahr früher waren
meine Eltern auf ihrer Reise nach Mailand über den Wallensee damit
gefahren.

Im Jahre 1833, als sich die Familie um einen Kopf vermehrte,
hatte sie mit ihren drei Töchtern nicht mehr gut Platz im Wollenhof, deshalb
kaufte Papa von Baumeister Chüri Stadler das Kronentor. Das alte
Kronentor, das den Neumarkt gegen den Kirschengraben abschließende
Tor mit einem hohen steinernen Turm, das im 15. und 16. Jahrhundert
die Familien Rordorf, Schwend und Meyer von Knonau bewohnt hatten,
war im Jahr 1827 abgetragen und an seine Stelle das heutige Kronentor
gebaut worden. Ein Teil des vormaligen Obmannamtgartens war dazu
als Gartenplatz abgetreten und dem früheren Turme gegenüber von
der Stadt ein laufender Brunnen errichtet worden. Das Haus war im
Rohbau fertig, als es Papa übernahm.
Vom Kronentor aus musste ich als 5-jähriges Kind auf den Münsterhof
in die Lismerschule, die von Jungfer Fehr geführt wurde. Zu jener Zeit
hatten alle Häuser im Neumarkt Kellerläden, die schräg in die Straße
hinausstanden und da machte es mir stets besonderen Spaß, auf jeden
Laden hinauf und wieder herabzuspringen. Ruhiger gelangte ich in
die Schule vom Engenweg aus, wenn’s regnete. Da setzte man mich in
einen Tragkorb, den Jakob Kägi am Rücken trug, so, dass ich gerade
noch mit meinem Rollenkopf darüber hinaus schaute und über Allem
spannte sich der Schirm Jakob's und schützte vor dem Nass werden. Das
soll ein gar artiges Bildchen gewesen sein. In der Schule lernte man
lismen und säumen und die Lehrerin pflegte den Unterricht zu begleiten
mit den Worten: „Hühnerbickli — Haberstichli — schöni Stichli“. Kamen
wir im Winter ins Kronentor, so ging die „Wildi“ wieder los und
wenn die Buben am Halseisen mir beim Schlitten zu nahekamen, so
überfuhr ich sie, während ich den Hälmi Däniker, der hervorragend bös
war und mich überfuhr, mit „Du bist en Säubub“ begrüßte. Bis ich kon-
firmiert wurde, huldigte ich dem Keßlerschlitten am Halsise. Ich hatte dazu
Hosen an, die länger waren als der Rock, mit „Anftöß“ unten von gleichem
Stoff wie dieser. Ich kletterte auch auf Leiterwagen, hatte meine eigene
Seiltänzerei, eine Stange auf zwei Böcken mit gekreideten Schuhen und
Balancierstange. Ging dann aber unsere Mama abends aus, so konnte ich
den ganzen Tag vorher weinen. Ging ich in eine Einladung, so musste ich
„brieggen“. Später freilich änderte sich das. Wenn meine guten Freundinnen
M. v. Planta und M. Pasteur alljährlich einmal ins Hôtel Baur kamen, dann
war ich so gerne bei ihnen, dass es Tränen gab, wenn sie wieder fortgingen.

Meine liebsten Erinnerungen aber knüpfen sich an den Letten, wo
die Großeltern wohnten. Hei! wie war es dort herrlich. Man pflügte
und ackerte, man drosch und buck sein eigenes Roggenbrot, man hütete
das Vieh und wälzte sich im Heu. Aber erst in der Kammer war's
großartig. Da stand eine große leere Bettlade und ein bedeckter Bad-
kasten, in dem man Haushaltis und Schuhschoppis spielte, oder dann
holte man den Kinderwagen mit den hohen Rädern herunter und fuhr
im Galopp in den hintern Letten. Elisi, Polini und Chäppi Heß waren
die wildesten dabei.
Unsere Kindermagd Babette Köberli aber sang uns gar schöne
Lieder vor, von denen das am häufigsten vorgetragene nachfolgenden
Reimen ging:
Geh, Schwester, lauf der Pforte zu
Es läut‘ wer an der Glocke:
„Wer störet uns in unserer Ruh?
Geh, greif nach Deinem Rocke“.
„Wer läutet?“
„Es stehet vor der Pforte hier
Ein repussierter Offizier
„Aus Preußen.“
„Sie haben doch die Gütigkeit,
Den Namen mir zu sagen.
Mein Amt erfordert jederzeit
Den Fremden auszufragen.“
„Ihr Name.“
„Dass man sogleich den Namen sagt,
Wenn nur ein Klosterfräulein fragt,
„Mit Nichten.“
„Herr Offizier, nur nicht so kühn,
In diesen Klostermauern —
Geh‘ ich zu der Frau Priorin,
So werden Sie's bedauern.“
„Ich gehe.“
„Was tut's doch viel, so geht nur hin
Zu meiner Bas der Priorin.
„Und meldet mich.“

„Wie! meine Frau wär‘ Ihre Bas,
Die Tante eines Helden?
Jedoch ich treibe keinen Spaß,
ich eile Sie zu melden.“
„So geht doch.“
„Frau Priorin, so hört mich an,
Ein Fremder lässt sich melden,
Ein schöner, ein galanter Mann,
Das Muster eines Helden.“
„O Wunder.“
„Jedoch mir wird verzweifelt bang,
Denn Ihr Herr Vetter wart‘ schon lang.
„Da kommt er.“
„Willkommen seien Sie mir Frau Bas,
Sie werden mich nicht kennen,
Jedoch, ich treibe keinen Spaß,
Ich eile mich zu nennen.“
„Ich heiße Hans von Pulverrauch,
Von Pulverrauch — so heiß ich.“
Die weitern Verse wurden uns Kindern verschwiegen.
Dass es bei all diesen Herrlichkeiten bisweilen spät wurde, bis wir
in den Engenweg zurückkehrten, ist selbstverständlich; aber dann war's
unsicher durch's Lettengäßchen zu gehen, wo gelbschwarze Salamander
so häufig waren, dass man oft darauf trat, trotz dem Laternli, ohne
welches man die Reise nie antrat.
Anno 1837 mussten wir eine Badekur in Schinznach machen. Ich
musste die „Ausschlächte“ bekommen. Die Mama ging mit uns drei
Töchtern. Aber Pauline und Illine, oder auch Pauli und Illi genannt,
waren nicht zu verbrauchen. Einmal, so geht die Sage, fiel Pauli aus
dem Bett auf den Boden und zerbrach da ein tönernes Gefäß, das
gewöhnlich in separatem Gehäuse oder unter dem Bett seine Aufstellung
findet und wurde dafür von der 4 Jahre jüngern Schwester mit dem
Zuruf „Du bist es Säuchind“ getadelt. Die älteste Schwester hielt es
hauptsächlich mit den im Bade anwesenden Franzosen und machte mit
ihnen Tagespartien.

Mein Vater
Während wir Töchter heranwuchsen, war unser Vater in seinem
Geschäft im Wollenhof und in öffentlichen Angelegenheiten
äußerst tätig. Im Wollenhof, der anno 1702 aus Geß‘schen
Händen in diejenigen der Familie Escher übergegangen war,
hatte schon mein Großvater, Zunft- meister Salomon Escher,
einen Seidengewerb geführt, der in den achtziger Jahren des 18.
Jahrhunderts zu großer Blüte gelangte, später aber unter den
Einwirkungen der französischen Revolution schwer zu leiden
hatte. Im Jahre 1806 starb mein Großvater und nachdem der
ältere Bruder meines Vaters, Joh. Jakob anno 1813 von der
Leitung des Geschäftes zurückgetreten war, übernahm mein
Vater mit seinem 2 Jahre jüngern Bruder Heinrich den Gewerb
und führte ihn unter der Firma Salomon Escher weiter. Die
beiden Brüder brachten denn auch durch ihre rastlose Tätigkeit
und durch ihre Umsicht den „Wollenhof“ bald so zu Ehren, dass
derselbe im zweiten und dritten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts
an der Spitze der zürcherischen Seidenstoff-Fabriken stand und
seinen Besitzern großes Ansehen und reichen Gewinn eintrug.


In den Zwanziger-Jahren beschäftigte der Wollenhof 500—550 Seiden-
weber im Umkreise von zwei bis dreieinhalb Stunden um die Stadt; eine
gleich große Zahl Weber hatten nur noch ein, höchstens zwei andere Fabri-
kanten aufzuweisen. Während bisher, für mehr als ein Jahrhundert lang,
Deutschland der Hauptabnehmer für zürcherische Seidenwaren und die Liefe-
rung von „Levantine“ nach Leipzig sozusagen ein Monopol des Wollenhofs
gewesen war, wurde von 1830 an Nordamerika immer wichtiger.
Salomon Escher war das erste Zürcherhaus, das zusammen mit den
befreundeten Firmen Christof Bodmer und Pestalozzi im Talhof ein
eigenes Haus für den Verkauf zürcherischer Seidenstoffe in New-York
führte. Die Seidenstoffe vom Wollenhof gingen hauptsächlich nach den
Südstaaten; der 1861 ausgebrochene Bürgerkrieg lähmte den Absatz-
sehr und im 79. Altersjahre meines Vaters (1867) erlosch die Firma-
Salomon Escher.
Neben seiner Tätigkeit im Geschäft widmete sich mein Vater in
Hervorragender Weise der Entwicklung Zürichs. Schon zu Anfang des
19. Jahrhunderts hatte man sich damit beschäftigt, das Kaufhaus, das
Kornhaus und die Schifflände einer Erweiterung, Umänderung oder
Verlegung zu unterziehen und eine zweite fahrbare Brücke über die
Limmat zu erbauen. Allein, das Resultat der vielen Beratungen und
Vorarbeiten war, dass man sich darauf beschränkte, an Stelle des alten
Helmhauses ein neues Gebäude zu errichten und den Hirschengraben
fahrbar zu machen. Eine Hauptursache des damaligen Misslingens der
Pläne war der ursprünglich von der Kaufmannschaft der Stadt Zürich
zusammengelegte Direktorialfonds gewesen, an welchen der Staat glaubte
Ansprüche stellen zu müssen. Nun war mein Vater schon in den dreißiger
Jahren von der zürcherischen Kaufmannschaft zum „Direktor“ gewählt
worden, d. h. zum Mitgliede jener Behörde, welcher die Wahrung der
kaufmännischen Interessen Zürichs oblag. Diese Ehrenstelle war für ihn
mit großen Mühen verbunden und nahm seine Kraft in hohem Maße
in Anspruch handelte es sich damals doch eben darum, mit der Regierung
einen Ausgleich über den erwähnten Direktorialfonds zu Stande zu
bringen und diesen Fonds wenigstens teilweise der Kaufmannschaft und
der Stadt Zürich zu retten. Nach unendlichen Mühen und den lang-
wierigsten Unterhandlungen, welche durch die damaligen Parteikämpfe sehr
erschwert wurden, gelang es meinem Vater am 22. März 1834 den
Vertrag zum Abschluss zu bringen.

Durch diesen Vertrag wurde der Direktorialfonds so verteilt, dass der
Kaufmannschaft Fr. 700,000 aushingegeben wurden,
während der ganze übrige Teil nebst gewissen Liegenschaften
an den Staat überging. Die Kaufmannschaft hatte dagegen die
Verpflichtung übernommen, folgende wichtige Bauten auszuführen: Den
Bau der Münsterbrücke, die Anlage der Quais vom Helmhaus zum
Rathaus und vom Helmhaus zur Thorgasse, das Ausgraben eines Hafens
auf der ehemaligen Kohlenschanze, Bau der Hafendämme, den Bau eines
neuen Kornhauses, die Anlage der Poststraße, den Durchbruch bei der
Thorgasse, den Abbruch des alten Grendels, des Wellenbergturmes
und des Wasserwerks an der obern Brücke.
Die Leitung des großartigen Unternehmens war von der Kauf-
mannschaft einer Vorsteherschaft von 15 Mitgliedern übertragen worden.
An der Spitze dieser Männer, welche mit großen Opfern an Mühe und
Zeit, ohne die mindeste Entschädigung die Einleitung und Aufsicht über
die sämtlichen Bauten und die Verwaltung übernahmen und alles glücklich
zu Ende führten, stand mein Vater als Präsident des leitenden Aus-
schusses. Ihm war hauptsächlich die Aufgabe zugefallen, tüchtige Techniker
zu gewinnen, ihren Ideen Geltung zu verschaffen und die erforderlichen
Verträge zum Abschluss zu bringen. Im Jahre 1843 war alles vollendet
und allgemeine Anerkennung wurde meinem Vater zu teil. Die Kor-
poration der in der Stadt verbürgerten Kaufleute sprach ihm in einer
Urkunde vom 4. März 1843 ihren wärmsten Dank aus. Der Stadtrat,
namens der Bürgerschaft überreichte ihm die goldene Verdienstmedaille
der Stadt Zürich und einen silbernen Ehrenbecher nebst einer Dankes-
urkunde; beides ist heute im Escher'schen Familienarchive aufbewahrt.
Eine Episode während dieser Zeit, deren ich mich lebhaft erinnere,
war die Einweihung der neuen Münsterbrücke am 20. August 1838.
Wir Kinder schauten von der „Meise“ aus dem Feste zu und ich sehe
noch meinen Vater, wie er, an der Spitze der vom Rathaus auf dem
neuen Quai herankommenden Festgesellschaft von Oberingenieur Negrelli
am Eingang der Brücke vor dem Helmhaus empfangen wurde, wie er
dann eine Rede hielt und wie Herrn Negrelli eine goldene Medaille
überreicht wurde. Die Festgesellschaft zog hierauf unter Glockengeläute.
und Kanonendonner über die Brücke bis zum Stadthaus, wo die Herren
von bekränzten Schiffen aufgenommen wurden und unter den Gewölben
der Brücke durchfuhren.

An den Treppen des neuen Quais wurde gelandet,
dort stieg man in eine große Zahl Wagen, deren erste beiden
vierspännig waren. Die Gesellschaft fuhr nun feierlich über die Brücke
und den Münsterhof durch die alte krumme Straße zwischen der Waag
und dem Zeughaus vorbei auf den Paradeplatz und von dort kamen
sie durch die neue Poststraße wieder auf die Brücke. Heller Jubel und
ein für uns Kinder unbegreifliches Gedränge entstand, als dann die
Brücke für jedermann geöffnet und Tausende von beiden Seiten über
sie hinwogten. Abends war großartige Beleuchtung der oberen und
unteren Brücke, der beiden neuen Quais, der Großmünstertürme und aller
Häuser, und als Schluss wurde ein Feuerwerk auf den Trümmern des
alten Wellenbergs abgebrannt, gleichsam als Triumph über dessen
Besiegung.
Im Herbst desselben Jahres (September 1838) unternahmen meine
Eltern mit Schwester Nanny eine Reise nach Mailand zur Krönung des
österreichischen Kaisers Ferdinand 1. Veranlassung zu dieser Reise gab
der Besuch einer, mehreren Zürcher Herren gehörenden Seidenspinnerei
in Ponte in der Brianza. In einer ihre Eindrücke sehr anmutig wieder-
gebenden Erzählung schildert meine Schwester die Fahrt im Vierspänner
nach Weesen, dann per Dampfboot „Linthescher“ nach Wallenstadt und
hierauf in Extraposten über den Splügen nach Mailand. Ganz geheuer
scheint es zu jener Zeit in der Brianza nicht gewesen zu sein, denn
einmal schreibt meine Schwester: „Herr M. erzählte, dass die Straße von
Ponte nach Mailand an mehreren Stellen so unsicher sei, dass er den
Weg nie mache, ohne Waffen mitzunehmen, um sich gegen die Angriffe
des Gesindels zu verteidigen. Wirklich trafen wir auch viele schwarze
Kreuze an, Merkmale der Stellen, wo Reisende ermordet wurden!“
Über den Einzug des Kaisers in Mailand sagt der Bericht: „Dem Zuge
voran gingen ein Regiment Kürassiere, denen die Infanterie mit Musik
folgte, dann kamen eine Anzahl von Wagen, in jedem ein oder zwei
Abgesandte der lombardischen Städte, die uns sehr zur Langweile wurden.
Nach diesen kam, was uns mehr interessierte, die Nobelgarde, die kaiser-
lichen Pferde, jedes von zwei Stallmeistern geleitet, und die kaiserlichen
Pagen, welche sich auf ihren weißen Pferden ganz allerliebst ausnahmen.
Dann erschien der goldene Wagen des Vizekönigs, derjenige des Gou-
verneurs und endlich derjenige des Kaisers.

Man konnte ihre Majestäten den Kaiser und die Kaiserin vollständig besehen,
da ihr Wagenoben ganz gläsern war. Händeklatschen empfing sie durch alle Straßen
bis zum Dom, wo sie ein Tedeum hörten, und diesen Beifall beantwor-
teten sie durch gnädiges Kopfnicken auf alle Seiten. Hinter dem kaiser-
lichen Wagen kam derjenige der Oberhofmeisterin, in welchem jene ganz
allein thronte und endlich noch ein Wagen der Ehrendamen der Kaiserin.“
Von einer Corsofahrt weiß sie nicht viel Rühmenswertes zu erzählen:
„Wir suchten in jedem schönen Wagen nach hübschen Leuten, fanden
aber meistens, dass dieselben einander gar nicht entsprachen, denn meistens
bestand, wenigstens der weibliche Inhalt derselben, entweder aus dicken,
alten, in allen Farben gekleideten Frauen, oder aus geputzten, bleichen
unansehnlichen Jüngferchen.“ Besser gefiel ihr die Vorstellung in der
Scala: „Das Haus war aus- und inwendig beleuchtet. Gerade taufend
Wachskerzen brannten vor den Logen und diese waren auch inwendig
beleuchtet. Die Damen waren alle in Gold, Seide und Edelsteine ge-
kleidet und Alles war würdig zum Empfange des Kaisers vorbereitet.
Mit dem Eintritt des Kaisers ging der Vorhang auf und rauschende
Musik, mit dem Beifall der Leute vermengt, begrüßte ihn. Er war in
weißer Uniform und die Kaiserin war brillant geschmückt. Die Auf-
führung bestand zuerst in einer für den Kaiser komponierten Cantate,
in welcher alle die ersten Sänger sangen, während die Tänzer National-
tänze aufführten. Durch Alles zog sich die Melodie von „Gott erhalte
Franz den Kaiser“ und die Worte, die ich nicht verstand, müssen auch
Schmeicheleien gewesen sein, denn immer ging das Beifallsgeklatsche
wieder an, dem der Kaiser und die Kaiserin durch Verbeugungen ant-
worteten.“ Der Aufenthalt in Mailand hat meiner Schwester ganz
besonders gut gefallen; am Tage vor ihrer Abreise und 6 Tage nach
ihrer Ankunft schreibt sie: „Wir saßen auf dem Domplatz. Ganz bezau-
bernd schön war doch an diesem Abend der Dom, der volle Mondschein
senkte seine sanften Strahlen auf denselben hinab, der reine blaue
Himmel war mit tausend Sternen besät und ich konnte mich beinahe
nicht von meinem Platz losreißen. Doch es war schon 1/2 10 Uhr und
es musste geschieden sein. Man moquierte sich sehr über meine Tränen,
die aus Mißvergnügen über meine baldige Trennung von Mailand sich
zu verschiedenen Malen durch meine Augen Bahn brachen. Noch ein
Blick auf den Dom, wahrscheinlich der letzte in meinem Leben, und wir
befanden uns wieder in unserer Dunkeln Straße gegen das Hotel Suisse.“

Der gleiche Kummer über zu schnelles Ende der Reise äußert
sich später noch einmal in dem Reisebericht. Auf der Heimreise blieben
meine Eltern mit Nanny vier Tage in Venedig.“ Bei ihrer Ankunft
fanden sie Briefe im Hotel vor, in welchen Papa gebeten wurde, den
Tag unserer Heimkunft zu bestimmen, da uns Großmama mit den
Kindern entgegenkommen wolle. Diesen Wunsch erfüllte nun Papa schon
jetzt und „wir mussten später dafür büßen“. Hatte Nanny in Mailand
„die schönen Menschen der ungarischen Nobelgarde mit ihren Tigerfellen
über den Rücken ausgezeichnet hübsch“ gefunden, so wäre sie bei dem
Café in Venedig, „wo nur Griechen und Türken einkehren, gerne stille
gestanden, um die ihr interessanten Menschen zu beschauen, hätten die-
selben nicht, ihrer Reize bewusst, nur zu bald bemerkt, wenn sie Gegen-
stand der Beobachtung waren“. Auf der Heimreise hatten sie viel Schlechtes
Wetter, Regen, Blitz und Donner und einmal konnten sie die vorgesehene
Station mit Nachtlager nicht erreichen. „Wir stiegen darum in dem
Wirtshaufe (in Kolnau bei Brixen) ab und wurden hier zuerst in eine
Art Wirtstube introduziert, die dem Geruche nach neben dem Stalle
gelegen war. Die Wirtin schien erschrocken, so späte Gäste zu erhalten.
und ließ die Magd uns die „Stub“ öffnen. Als der Schlüssel zu der
„Stub“ gefunden worden, führte man uns hinauf und bot uns dann
gleich „ein Hähnerl und etwas Mehlspeis“ an, da der Fleischvorrat
erschöpft sei. Betten befanden sich auch in der Stub und in einer
Kammer daneben. Trotz allen Zusprechens aber konnten wir nur zwei
leinene Betttücher erhalten; die andern bestanden aus Baumwolle.
Interessant, weil so ganz anders als heute, ist die Bemerkung meiner
Schwester über das Vorarlberg. „Diese Gegend ist außerordentlich arm
und die Kinder, deren man so viele halb nackt sieht, flößten uns großes
Mitleid ein. Nachdem wir diese unfruchtbare Gegend und diese armen
Leute gesehen hatten, verwunderten wir uns nicht mehr, dass so viele
Tyroler ihr Brot auswärts suchen.“
Endlich war das Heimatland in der Nähe, genau zur vorgenom-
menen Zeit, „denn Papa gab durch das ganze Tyrol zu unserer schnelleren
Beförderung doppelte Trinkgelder.“ „Aber noch stand eine große Über-
raschung bevor. Papa hatte geglaubt, es seien durch das Toggenburg
Posten eingerichtet und wir wollten von Feldkirch über den Rhein gegen
Wildhaus fahren. Allein Posten gab's keine und weil weder Brücke
noch Schiffbrücke über den Rhein führte, konnten wir nicht vorwärts.

Und doch sollten wir notwendig morgen in Rapperswyl fein, wo uns
unsere Leute erwarteten. In der größten Angst und strömendem Regen
warteten wir im Wagen, während Papa mit den umstehenden Kutschern
ratschlagte. Endlich, vermöge Geld und guter Worte, wurde ein Lohn-
kutscher gemietet und diesem eine Belohnung versprochen, wenn er uns
heute noch über den Rhein bringe. Wir fuhren also einige Stunden
zu und langten dann am Ufer des Flusses, der sehr klein war, an.
Hier befand sich ein ziemlich kleines Schiff mit zwei Schiffleuten; unsere
Pferde wurden ausgespannt und hineingestellt, während der Wagen auf
einige Bretter geladen, in der Mitte des Schiffes stand. Ich fürchtete
mich entsetzlich während dieser Fahrt, dennoch langten wir aber glücklich
in der Schweiz an. In Wildhaus wurden wir von einem wahren
Schweizerwirt empfangen, der uns immer unterhielt und sich sogar mit
uns zu Tische setzte. Man brachte uns ein braves Nachtessen und führte
uns dann in das Zimmer, wo man mit dem Kopf an die Decke anstieß.
Wirklich war es auch hier so kalt (am 16. September), dass man geheizt
hatte und es soll hier den ganzen Sommer keine Woche gewesen sein,
wo nicht Schnee fiel.“ Am letzten Tag der Reisebeschreibung bedauert
die Schwester abermals, dass die Zeit der Reise so geschwind verflossen.
sei, „doch freute ich mich auch ein wenig, meine lieben Verwandten wieder-
zu sehen“. In Rapperswyl waren sie dann allerdings nicht, was Großen
Schrecken hervorrief; dafür ein Brief, der auf Weilen vertröstete. „Wir
essen geschwind zu Mittag und gehen weiter und in Meilen wirklich
finden wir unsere Familie vom 1. Großpapa bis zur Elise glücklich und
gesund. Das war nun eine große Freude für Alle und des Erzählens
war kein Ende. Gegen Abend fuhren wir nach Hause und mussten
gestehen, dass, obgleich die italienischen Seen schöner waren, der Zürichsee
doch auch nicht hässlich ist.“
„In Zollikon hatten wir dann noch ein Abenteuer; neben der Schmiede
bricht ein Rad von unserem Reisewagen, der bis jetzt so treu gedient
hatte. Der Unfall war aber bald wieder hergestellt und wir kamen
bei guter Zeit zu Hause an, zufrieden mit dem vielen Schönen, das wir
gesehen hatten, und welches uns durch unser ganzes Leben angenehme
Erinnerungen zurücklassen wird.“ So schließt die Beschreibung einer
Reise, die vor fast auf den Tag vor 71 Jahren unternommen wurde.

Münsterbrücke
Nun kam die Zeit des Lernens für mich; ich trieb Französisch bei
Herrn und Frau Denzler und Englisch bei Herrn Hegner. Meine
besondere Liebhaberei war die Raupenzucht. Ich hatte bis 30 Drückli
mit Rübli-, Nessel-, Oleander-, Herdöpfel- und andern Raupen. Alle
Drückli wurden in eine Schublade versorgt und jeden Morgen, bevor-
ich in die Schule ging, fütterte ich die Raupen, jede mit dem ihr
zusagenden Kraut. Hatte sich der Schmetterling aus der Puppe ent-
wickelt, so ließ ich ihn fliegen. Eine weitere meiner Liebhabereien war-
das Ablösen der Schale von jungen Hühnern, wenn sie aus dem Ei-
krochen. Waren darunter junge Enten, so wollten sie ins Wasser, was
die Gluggeri nicht zugeben wollte.
Eine andere Erinnerung betrifft die Pilgerzüge, die, aus dem
Großherzogtum Baden kommend, durch Unterstraß nach Einsiedeln zogen.


Sie trugen meistens badensische Tracht, hatten große runde Hüte oder
kleine Käppli, in den Händen eine grob geflochtene Tasche oder einen
Rucksack umgehängt und beteten halblaut vor sich hin „Maria Mutter
Gottes bitt‘ für uns arme Sünder jetzt und in Ewigkeit, Amen“.
Aus der Schule kommend trafen wir bisweilen beim „weißen
Haus“ die von Einsiedeln zurückkehrenden Züge an, und dann machte
ich mich gern an die Frauen und bat: „Gend mer au es Muttergöttisli“.
Die Frauen gaben mir dann hin und wieder eines, das ich triumphierend
heimtrug und dazu sang:
Liebi Lüt was bringed er hei
An leere Säckel und müdi Bei!
In dieses fröhliche Getriebe kam dann der böse 6. September 1839.
Man hatte ja schon seit Monaten von der Berufung des Dr. Strauß
von Ludwigsburg an die Hochschule viel gesprochen und noch mehr
gelesen, aber da mein Vater in solchen Sachen liberal war, hatte man
im Engenweg kein großes Interesse an der Frage genommen. Mein
Vater war am 6. September abwesend in Frankfurt a. M. Schon
am Tage des 5. September brachten die Mägde und Knechte alar-
mierende Berichte in den Engenweg. Es werde auf dem Lande Sturm
geläutet; bewaffnete Mannschaften von Pfäffikon, Hittnau, Bauma seien
im Anzug. Der Strom wachse von Dorf zu Dorf; in Volketsweil sei
die Kirchentüre gewaltsam erbrochen worden; dort habe man sich mit
Scharen von Fischenthal, Wetzikon und anderen Gemeinden des östlichen
Kantons vereinigt und ziehe nun 2000 Mann stark gegen die Stadt,
um die Regierung zur Abdankung zu zwingen. Früh am Morgen des
6. Septembers hieß es, der „Landsturm“ stehe in Oberstraß bei der
Linde und die Leute verlangen, nach der Stadt geführt zu werden. An-
der Spitze der aufständigen Bewegung stand Hürlimann-Landis von
Richtersweil und Dr. Rahn von Zürich; ihre Devise war „Das Zürcher
Volk — ein hehres Volk“. Später wurde berichtet, der Zug bewege
sich gegen die Stadt, voran eine kleine Abteilung Scharfschützen und
sonst Bewaffnete, und ihnen folgen ungefähr 2000 Mann mit Stöcken
mannigfaltiger Art versehen. Sie sängen Lieder aus dem Gesangbuch
und sie beabsichtigen das Postgebäude zu stürmen, wo die Regierung
ihre Sitzungen hielt. Ich erinnere mich, wie Kantonsrat Studer, der in
Wipkingen wohnte, in die Stadt ritt; das Weitere erfuhr man vom
Hörensagen.

Als der Zug der Landleute aus der Storchengasse auf
den Münsterhof vorzudringen suchte, fand er den Ausgang mit Kavallerie
besetzt. Diese rief den Leuten ein „Zurück“ zu, aber bei dem tobenden
Lärm war weder dieser Zuruf, noch der Ausruf von Pfarrer Hirzel
verstanden worden, welcher, an die Spitze der Landleute tretend, rief:
„Wir kommen bloß um friedliche Unterhandlungen mit dem Regierungs-
rat fortzusetzen; ich beschwöre Euch, beginnt keinen Bürgerkrieg“. Ein
auf Pfarrer Hirzel mit gezücktem Säbel zusprengender Dragoner und
ein Schuss von den Landleuten gab das Zeichen zum Kampf, der sich
dann auf dem Münsterhof abspielte. Auf dem „Neumarkt“ (dem
heutigen Paradeplatz) angekommen, stürzten sich die Landleute mit auf-
gehobenen Stöcken und mit dem Geschrei „Schlagt sie nieder“ gegen
das bei den Zeughäusern aufgestellte Militär, worauf dieses seinerseits
Feuer gab. Die Kavallerie brach vom gelben Zeughaus hervor und
hieb in die Massen ein. Während dieser furchtbaren Szene gab der
Regierungsrat, der von feinem Sitzungssaale aus dem Treiben in der
Poststraße zugesehen, den Befehl, dass man zu feuern aufhören solle.
Regierungsrat Hegetschweiler überbrachte diesen Befehl dem Militär-
posten beim gelben Zeughaus. In dem Moment aber, als Hegetschweiler
gegen das Postgebäude zurückkehren wollte, erhielt er einen Schrotschuss
über dem Auge und fiel blutend zu Boden. Wenige Tage nachher
erlag er seinen Wunden. Das Militär zog sich in die Kaserne zurück
und soll sich dann aufgelöst und nach allen Richtungen hin zerstreut
haben. Die Kavalleristen entflohen in der Richtung gegen das Sihlfeld
hin und die meisten setzten bei Wipkingen über die Limmat. Besonders
tapfer entfloh der Kommandant der Militärmacht, Sulzberger, der in
Frauenröcken mit Hut und Schleier von Prof. Locher in einer Kutsche
mit zwei Rappen an die Sihlbrücke geführt wurde. Ich erinnere mich
noch des Dirggels, den ich zum Gutjahr von der Tantegotte erhielt, auf
dem dieser Hergang bildlich dargestellt war. Noch geschwinder floh die
Volksmasse; die meisten verließen in aller Eile, ihre Stöcke wegwerfend,
über die neue Münsterbrücke nach allen möglichen Richtungen die Stadt,
manche flohen aber weiter über den Zürichberg und bis nach Hause.
Der ganze Putsch dauerte höchstens 10 Minuten.
Unmittelbar nach der Flucht der Landleute begann in der Stadt
das schauerliche Sturmgeläute von allen Türmen, das Zeichen, das von
den Führern der Volksmassen mit der Seegegend verabredet worden
war, für den Fall, dass Zuzug auch von dorther gewünscht werde.

Bald nach 11 Uhr rückte der erste Trupp Leute vom rechten Seeufer in
Schiffen herbei, geführt von Spöndlin. Sie waren durch die erhaltenen
Nachrichten, namentlich von dem Schießen aus der Waag und von dem
Fall Hegetschweiler so aufgebracht, dass sie nur mit großer Mühe von
dem Sturm auf die Waag abgehalten werden konnten, dann aber wut-
entbrannt durch die Poststraße über den Neumarkt, wo sie die Blutspuren
sahen, gegen die Kaserne eilten, um diese zu stürmen. Aber diese war
bereits leer!
Unaufhörlich rückten neue Scharen des Landsturmes, bewaffnet mit
Morgensternen, Sensen, Speeren, Hellebarden, Keulen und versehen mit
allen möglichen Schießgewehren in die Stadt und man fürchtete für die
Mitglieder der Regierung und die bekannteren sogenannten Radikalen.
Ein Teil war indessen bereits entflohen und andere entfernten sich jetzt
oder bald nachher. In dem verlassenen Regierungsratsaale konstituierte
sich dann ein provisorischer Staatsrat unter dem Bürgermeister J. J. Heß
und dem Regierungsrat L. Meyer von Knonau. Die infolge des Sturm-
läutens bis spät nachts nach der Stadt gekommenen Mannschaften
wurden, soweit sie es nicht schon waren, bewaffnet und in der Kaserne,
im Großmünster, Fraumünster und Prediger einquartiert, wo sie auch
Speise und Trank erhielten. Ich erinnere mich, dass es im Laufe des
Nachmittags einmal hieß, wir müssten den unbewohnten Teil des Kronen-
tors als Nachtlager hergeben; es kam dann aber nicht dazu. Einen
großen Eindruck machte es auch auf mich, als man sagte, die neun
Gefallenen des Aufruhrs seien in der Predigerkirche ausgestellt.
In der Nacht vom 7. zum 8. September gab es Lärm auf ein-
Gerücht, aargauische Truppen seien im Anzug, das Militär und die Bürger-
wachen stellten sich in Bereitschaft und es wurden eine Anzahl Kanonen
aufgefahren.

Pauline und Elise
Im Jahr 1841 verlobte sich meine Schwester Nanny. Das war ein
Ereignis, als der schöne stattliche Herr Stockar, aus Amerika heimge-
kommen, in die Familie kam! Wir Kinder sagten ihm vor lauter
Respekt immer „Sie“. Die Hochzeit wurde in Bassersdorf gefeiert und
ich erinnere mich des Bedauerns, das ich für den Bruder des Bräutigams
empfand, als er sich beim Zuschlagen des Kutschenschlages die Hand
blessierte.
Im Jahre 1843 gaben die Eltern unserer Tanzherren einen Bal
costumé. Ich hatte ein gar nettes Marketender-Kostüm mit rotem
Umlauf und schwarzem Sammt-Jäckli, weißen Puff-Ärmeln und einem
schwarzen Marketenderhut. Darin musste ich mich im Schönenberg zeigen
und als ich heimkam, erzählte ich meiner Mama, „es ist nüt gsi als
Kompliment, Schmeicheleien und Höf“. Zu diesem Ball war ich von
Oskar Meiß eingeladen, der in gar sinniger Weise seine Einladung in
einen selbstgemachten Rebus kleidete. Auch Elise war am Balle als
Tyrolerin, Nanny Stockar als hübsche Luzernerin und Conrad Stockar
war als Grieche erschienen.


In jenen Jahren fanden regelmäßig die Escherfeste des Escher-Fonds
statt; sie waren das Ereignis des Winters. Sie wurden gewöhnlich
im Kasino — dem von der Assemblée auf die Tagsatzung von 1807
hin erbauten Gesellschaftshaus — abgehalten und fanden ihren Abschluss
mit Theater oder Essen, an denen man farbige Säcke mit „Chram“
bekam. Bei diesen Festen machte der Sohn des Herrn Escher im Felsen-
hof „pluie und beau jour“, er war witzig und geistreich und war mit
einer schönen Engländerin verheiratet. Dr. Alfred Escher machte damals
auch viel von sich reden; er hatte im Jahr 1845 mit andern zu einer
Volksversammlung auf der Wiese beim Kreuz in Unterstraß eingeladen
zum Protest gegen den Einzug der Jesuiten in den Kanton Luzern; im
gleichen Jahr zum dritten Tagsatzungsgesandten gewählt und als zürche-
rischer Staatsschreiber trat er gegen den Sonderbund auf. Er wurde
für einen großen Teil der Escher so radikal, dass sie nicht mehr mit ihm
zusammen sein wollten. Als dann noch der Umstand dazu kam, dass
eine andere Familie schlechter Geschäfte wegen nicht mehr an dem Feste
teilnahm, wurden die Essen nicht mehr abgehalten.
Ich hatte viele Freundinnen: Anna Rahn, Emilie Widmer, Pauline
Balber, Amalie Meyer, Luise Meyer. Weiter verkehrte ich viel mit
Setti Koller. Sie war die Tochter eines Nachtwächters oder Stundenrufers,
der zur Nachtzeit, mit Stock und Säbel bewaffnet, durch alle
Straßen und Gassen der Stadt zu patrouillieren hatte. Sie kam regel-
mäßig alle Abende zu mir und wir spielten zusammen „Zum Törli us.“
Dann war s‘ Dödeli Ruegger. Es hatte längere Zöpfe als es groß
war und ich sollte es erziehen; aber die Resultate blieben so ziemlich
aus. Deine Mitkonfirmandin war s‘ Regeli Gottschall. Es war seinerzeit
allgemein Gebrauch, dass die ärmeren Konfirmandinnen, die als
Dienstboten in der Stadt waren und keine Zeit zum Nachschreiben des
„Unterrichts“ hatten, einer begüterten Konfirmandin „zugeteilt“ wurden,
welche die Verpflichtung übernahm, für sie zu „schreiben“, und ihr für
die Konfirmation Shawl, Rock und Buch zu stiften. s‘ Regeli war mir
eine liebe Freundin; ich war später mit Elisi an seiner Hochzeit in
Steinmaur. Am Hochzeitsschmaus bekamen wir besonders gute Schmalz-
bohnen, und was mir aufgefallen, war, dass die Mütter des jungen
Paares zur Trauung nicht in die Kirche kommen durften, weil sie für
die Hochzeitsgäste kochen mussten.

Nach und nach kam für mich die Zeit, wo ich in die „Pension“
gehen sollte. Allein viel lieber saß ich beim Großvater im Letten, der
damals krank war; je näher die Zeit des Fortgehens kam, umso mehr
bat ich, mich doch daheim zu lassen. Und so geschah es, ich kam nie fort.
Um 1844 herum begann mein Vater sich mit der Eisenbahn Zürich-
Basel zu beschäftigen. Ich erinnere mich, wie die Mutter oftmals klagte,
dass er so unruhig schlafe und wie sie Angst habe, er schieße einmal
in der Nacht seine Jagdflinte ab, die immer geladen über seinem Bett hing.
Papa ging dann oft nach Wien, einmal um die großen Wiener
Bankhäuser zur Aktienbeteiligung zu veranlassen, dann aber auch, um
von der österreichischen Regierung eine Urlaubsbewilligung für den, ihm
von der Münsterbrücke her bekannten Ingenieur Negrelli, damals General-
direktionsinspektor der österr. Staatsbahnen, zu erwirken. Negrelli war
von ihm für die Oberleitung des Baues in Aussicht genommen. Große
Freude war es für meinen Vater, als ihm dies gelungen war und in
meinem Sparbüchli finde ich heute noch den Eintrag von dem Batzen,
den er mir bei diesem Anlass „von Wien“ heimbrachte.
ich muss hier doch noch einschalten, wie wir in den 30er und 40er
Jahren reisten und unsere Briefe beförderten, denn heute, wo der
Briefträger 6mal täglich ins Haus kommt und das Eisenbahnbuch so dick
ist wie der damalige Bürgeretat, hat man keinen Begriff mehr, was
ein Brief zu jener Zeit war, und welches Unternehmen damals eine Reise
vorstellte.
Mein Vater erzählte uns oft, wie anno 1830 ein täglicher Eilwagendienst
zwischen Zürich und Basel eingerichtet wurde; es soll aber
nicht nur Freude über diese „vorzügliche“ Verbindung zwischen den beiden
Städten geherrscht haben, sondern auch Zweifel ausgesprochen worden
sein, ob ein solches Unternehmen Bestand haben werde. Als dann
um 1835 herum ein täglicher Eilwagenkurs zwischen Zürich und Bern
eingerichtet wurde, der die Strecke in 14 Stunden zurücklegte und
wodurch es nicht mehr nötig war, die Hälfte des Tages und die ganze
Nacht im Postwagen zu sitzen, da war man überzeugt, große Fortschritte
gemacht zu haben.
Noch 5 Jahre später aber hatte sich die Zahl der Posten stark
vermehrt, und ein gar lustiges Schauen war es, wenn die zwei-, drei-
und vierspännigen Posten aus dem neuen Posthof nach allen Seiten abrollten.

Früh 6 Uhr fuhr der Eilwagen nach Bern ab, um 7 Uhr
folgte der Eilwagen nach Chur, um 8 Uhr aber knallte es vornehmlich,
wenn gleichzeitig die Posten nach St. Gallen, Konstanz, Brunnen, Glarus,
Basel und Karlsruhe (via Eglisau-Freiburg) sich in Bewegung setzten.
Die Posten nach Schaffhausen und Luzern fuhren etwas später und im
Laufe des Nachmittags verreisten die Postwagen nach Aarau, an die
beiden Ufer den See hinauf und nach Winterthur. Täglich abends 6 Uhr
ging der französische und Frankfurter Courrier ab, 4mal wöchentlich
der österreichische und bayerische und 3mal wöchentlich der italienische
Courrier.
Im Jahre 1843 wurde das „Frankaturzeichen“ eingeführt und die
Taxe einheitlich auf 6 Rappen für den Kanton und auf 4 Rappen für
die Stadt festgesetzt. Bis zu jener Zeit hatte man die Briefe auf die
Post getragen und die Taxe in bar bezahlt, was mit Rotstift auf dem
Brief vorgemerkt wurde; auch in der ersten Zeit des Bestehens der Brief-
marke wurde die Taxe meistens noch durch Barzahlung erlegt und keine
Marke aufgeklebt, wenn der Brief überhaupt frankiert wurde, was
nicht überallhin geschehen konnte.

Bahnhof
Hand in Hand mit dem Bedürfnis schneller vorwärts zu kommen,
ging das Interesse für die seit einigen Jahren in andern Ländern, speziell
in England, in Betrieb gesetzten Eisenbahnen.
In Zürich nahm sich dieser Neuerung eine Gesellschaft an, an deren
Spitze Conrad von Muralt stand, und sie erhielt auch im Jahr 1839
vom zürcherischen Großen Rat die Bewilligung zum Bau einer Eisenbahn
von Zürich nach Basel. Allein von den damals zur Subskription auf-
gelegten Aktien wurde kaum ein Drittel gezeichnet und so beschlossen
die Initianten im Jahre 1841, die „Basel-Zürcher-Eisenbahngesellschaft“
aufzulösen. Dieser Misserfolg veranlasste Gerold Meyer von Knonau
in seinen „Gemälden der Schweiz“ im Jahre 1844 zu schreiben: „ob
der Kanton Zürich je eine Eisenbahn erhalten werde, bleibt dahingestellt.“
Im Februar 1842 erwarb mein Vater die von der „Bafel-Zürcher-
Eisenbahngesellschaft“ zum Verkauf ausgebotenen Vorarbeiten, Pläne,
Studien und Messinstrumente für Fr. 3600. Es ist mir noch wohl
erinnerlich, was für Vorstellungen ihm dann gemacht wurden.


Neben den überhaupt gegen jede Eisenbahn ins Feld geführten
Gründen wurde der schon früher gemachte Einwand wiederholt, es sei
vorerst zu untersuchen, ob nicht die Limmat, Aare und Rhein so vertieft
und ihr Bett so verbessert werden könnte, dass sie mit Dampfbooten
befahren werden könnten.
Es wurde meinem Vater nicht leicht, seine Mitbürger von der
Zweckmäßigkeit der Bahn zu überzeugen. Zuerst gelang ihm dies bei
seinen engern Landsleuten: eine Reihe von zürcherischen Gemeinden
richteten Petitionen an den Großen Rat mit dem Gesuch „es möchte
die hohe Landesbehörde sich mit den andern beteiligten Schweizer-
regierungen befreunden und suchen, mit diesen ein Werk auszuführen,
dass ihnen und dem Vaterlande zu großem Vorteil und zur Erhaltung des
Wohlstandes gereichen werde“. Die Basler taten dagegen ihr Möglichstes
um den Anschluss von Zürich an deutsche Bahnen zu verhindern - sie
waren der „große Verdruss“ für meinen Vater. Bafel erklärte, dem
Unternehmen einer Basel-Zürcher-Eisenbahn nicht abhold zu sein, aber
es wäre nicht im Falle, hierfür größere Opfer zu bringen. Gegen-
wärtig halte es den Zeitpunkt nicht für geeignet, unmittelbare Schritte
für den Bau einer Eisenbahn zu tun, sondern rate zuzuwarten und zu
gewärtigen, wie sich die badischen Eisenbahnverhältnisse gestalten werden.
Noch entschiedener riet Baselland ab. Am 4. Mai 1843 schlug
dessen Regierung die Einladung zu einer Konferenz in Sachen der Basel-
Zürcher-Eisenbahn mit folgender Motivierung aus: „Wir dürfen Euch,
getreue liebe Eidgenossen, nicht verschweigen, dass wir in der Gewissheit
leben, es werde keine Eisenbahn unserem Kanton die Vorteile jemals
ersetzen können, welche derselbe bei den gegenwärtigen Verkehrsmitteln
und der jetzigen und in Zukunft zu erhoffenden Entwicklung des Handels
und Wandels daraus zieht und es würde die Ausführung einer Basel-
Zürcher-Eisenbahn nach dem früher bekanntgewordenen Plane den Rhein-
aufwärts nach der Mündung der Aare in denselben, den Bewohnern
der Landschaft eine Hauptquelle ihres Wohlstandes, welche sie in dem
äußerst lebhaften Durchgang von Reisenden und Handelsgegenständen
durch denselben findet, mit einem Male abgraben.“
Als sich aber mein Vater die Mithilfe Negrelli's gesichert hatte,
nützte kein Angstmachen mehr, zusammen mit C. Ott-Imhof, Schultheß-
Landolt, S. Pestalozzi und Schultheß-Rechberg gründete er eine neue
Aktiengesellschaft und der zürcherische Große Rat beschloss am 26. Juni
1845 „das Vorhaben der Erbauung einer von Zürich längs dem Rheine
als Verbindung mit Basel und den dort ausmündenden französischen
und großh. badischen Eisenbahnen, sowie in westlicher Richtung vorläufig
bis Aarau gehenden Eisenbahn im Allgemeinen gutzuheißen“.

Die Konzession wurde auf die Dauer von 75 Jahren erteilt unter der Ver-
pflichtung, dass die Bahn alle nötigen Vorkehrungen treffe für die private
und öffentliche Sicherheit, dass sie den Staat entschädige für ihm eventuell
entgehende Einnahmen am Postregal, Weg- und Brückengeldern, dass
sie bei effektivem Kriegsdienst die Truppen-Fuhrwerke und -Pferde zur
hälfte der niedrigsten Taxen spediere und dergl. Dagegen erhielt die
Gesellschaft das Recht der Expropriation von Privateigentum. Eine
ähnliche Konzession erteilte der Große Rat von Aarau.
Wie sehr die Anhandnahme des Baues der Eisenbahn die ganze
zürcherische Bevölkerung am Ende dann doch freute, zeigte sich am
Sechseläuten 1846, als sämtliche Zünfte meinem Vater einen großartigen
Fackelzug vor dem Kronentor brachten. Der Zug bestand aus 800 Fackel-
trägern, nebst 13 Zunft-Präsidenten, 26 Trägern der Ehren-Geschirre,
26 Marschällen und dem Stab und Pannerträgern. Die Ansprache im
Namen der Zünfte hielt Oberst Bürckly-Füßli und in seiner Antwort sagte
mein Vater: „Wenn wir es wagten, ein solches Unternehmen zu beginnen,
so wurden wir dabei durch die Erfahrung ermutigt, dass gemeinschaftliches
Zusammenwirken und feste Beharrlichkeit zuletzt doch alle
Schwierigkeiten beseitigen ... Wir hoffen und wünschen, dass unser
Unternehmen zunächst unserer Vaterstadt, dann aber auch dem nähern und
weitern Vaterlande Nutzen und Ehre bringen werde und dass sich, wie schon
von Anfang an, immer mehr die entzweiten Kräfte vereinigen, um dem ganzen
Vaterlande allen gehofften Nutzen zu sichern. Jedenfalls wird unserer
Vaterstadt die Ehre bleiben, die Eisenbahn in der Schweiz ins Leben gerufen
zu haben; mögen nun alle diesfälligen Wünsche in Erfüllung gehen, möge
die Eisenbahn ein neues Mittel werden, den Wohlstand unserer Vaterstadt
zu befördern.“ Sänger trugen zwei speziell für diesen Anlass gedichtete
Lieder vor und ein silberner Becher mit der Widmung: „Die Stadt
Zürich Herrn Martin Escher“ und den Emblemen der Münsterbrücke und
des neuen Kornhauses wurde meinem Vater überreicht. Nach noch vorhan-
denen Aufzeichnungen wurde für den Empfang der Fackelträger im
Kronentor bereitgestellt: 426 Maaß Eigenthaler 1811 er und 1600 Zigarren.

Nachdem am 16. März 1846 die Generalversammlung der Aktionäre
den Bau der Bahn bis Baden beschlossen hatte, begannen rasch die
Anordnungen zum Bau der Bahn. Die Städte Zürich und Baden machten
der Gesellschaft Schenkungen an Grund und Boden für die Bahnhöfe,
aber viele Schwierigkeiten bereitete die Erwerbung des Landes von den
Privaten. Dann aber auch ungeahnte technische Schwierigkeiten bei der
Sihl, der Reppisch und besonders auf der Strecke Wettingen-Baden.
Der Baugrund war da von der schlechtesten Beschaffenheit und es mussten
die kostbarsten Vorkehrungen getroffen werden, um das Abrutschen
sowohl der Bahn selbst, als der nahe gelegenen Poststraße zu verhüten. Auch
der Tunnelbau zu Baden bot besondere Schwierigkeiten, indem der
südliche Abhang des Schlossberges eine große Masse zerklüfteter, mit
Thonadern durchzogener Felsen enthielt, so dass die ganze Masse in
Bewegung geriet. Wertvolle Weinberge wurden dadurch zerstört und
mehrere Gebäude bedroht, was bedeutende Entschädigungen nach sich zog.
Die Lokomotiven wurden von Kezler in Karlsruhe verfertigt. Riggen-
bach — der spätere Erbauer der Rigibahn — brachte sie nach Zürich
und erzählte, wie die ehrbaren Basler-Bürger bedenklich ihre Köpfe
schüttelten, als er die Lokomotiven über die alte Rheinbrücke führte.
Das Personal durfte auf besondere Vergünstigung der Großh. Badischen
Bahn bei ihr zu Lokomotivführern, Kondukteuren usw.. ausgebildet werden.
Die Wagen wurden in Wien gebaut und zwar so, dass man ohne Gefahr
durch den ganzen Zug durchgehen konnte.
Endlich rückte der Tag der Einweihung, 7. August 1847 heran.
Für meinen Vater war es ein Tag wohlverdienter Ehrung. Es mochte
etwa 12 Uhr sein, als Kanonendonner das Herannahen des Zuges
verkündete, der die in Baden abgeholten aargauischen Behörden und
Gäste brachte. In dem mit Pflanzen reichgeschmückten Wartsaal des
Bahnhofes wurden sie von meinem Vater mit einer Ansprache begrüßt.
Als Stellvertreter des Aargau antwortete Landammann Siegfried mit
Worten wohlwollender und freudiger Anerkennung. Nach einem Rund-
gang setzte man sich in den Zug. Die Lokomotive „Aare“, mit
Blumen bekränzt, war vorgespannt; auf ihrem Vorderteile standen in
alter Waffenrüstung und mit Bannern in der Hand zwei zürcherische
Lokomotivführer: ein dritter leitete die Maschine. Sodann folgte ein
Wagen mit Musik, ihm nach weitere 12 Wagen mit den Gästen. Längs
der Bahn waren die meisten Wächterhäuschen mit Eichenlaub und
Blumengirlanden verziert. In 35 Minuten war man in Baden.

Beim Aussteigen wurden Blumensträußchen ausgeteilt und von weiß gekleideten
Kindern wurde meinem Vater ein Lorbeerkranz angeboten, den er aber
nicht annahm. Der Ausgang aus dem Bahnhof war mit einem Triumph-
bogen, Inschriften zu Ehren des Präsidenten enthaltend, geschmückt.
Man begab sich nun in den Gasthof zum Schiff, wo das Festessen statt-
fand. Zahlreiche Trinksprüche wurden gehalten und Frau Stadtammann
Hanauer von Baden bekränzte meinen Vater mit einem Lorbeerkranz. Um
7 Uhr kehrten die Zürcher heim, nachdem ihnen auf dem Bahnhof
nochmals der Dank des Aargaus ausgesprochen worden; es galt dieser
Dank, unter Hinweisung auf das, was ein anderer Escher für die Linth-
unternehmung getan, vor allem meinem Vater, der sich mit so viel
Hingebung der Eisenbahnunternehmung gewidmet habe.
Mit dem Weiterbau der Nordbahn dauerte es viel länger, als ihre
Gründer gedacht hatten. Die anhaltend ungünstigen politischen und
finanziellen Verhältnisse geboten den einstweiligen Stillstand. Von der
Postverwaltung erreichte man vorderhand so viel, dass die Eilwagen von
Basel und Bern nur noch bis Baden gingen und dort ihre Passagiere
und Güter an die Bahn abgaben. Hemmend trat anfangs der 50er
Jahre dem Weiterbau auch entgegen, dass man nicht wusste, was die
Bundesbehörden über den Ausbau des schweiz. Eisenbahnnetzes beschließen
würden, ob Staatsbau oder Privatbau obsiegen werde. Im Sommer
1852 entschieden sich beide Räte mit großem Mehr für den Privatbau.
Im folgenden Jahre beantragte mein Vater die Fusion der Nordbahn
mit der neugegründeten Zürich-Bodensee-Eisenbahngesellschaft und es
ging daraus die Schweiz. Nordostbahn-Gesellschaft hervor.
Bis 1858 blieb mein Vater Präsident der Direktion und später des
Verwaltungsrates der N.O.B. Tag für Tag ging er auf den Bahnhof,
erfüllt von dem lebendigsten Interesse und ängstlicher Sorge für das
Gedeihen des jungen Unternehmens. Und als er ein alter Mann
geworden, da schaute er noch vom Engenweg aus hinüber auf seine
Bahn und zählte beim Eindunkeln die Laternen, die längs der Linie
angezündet wurden. Sieben bis neun zählte er! Und wenn er sich dann
etwa freute, dass es ihm gegen die wuchtige Opposition Dr. Alfred
Eschers gelungen sei, die Verlegung des Bahnhofes ans Seeufer zu
verhindern, wer wollte es ihm heute nicht danken, wenn er am Quai
lustwandelt.

Engenweg
Dass bei der intensiven Beschäftigung meines Vaters mit der Bahn
die politischen Begebenheiten jener Zeit sehr in den Hintergrund traten,
lässt sich begreifen. Aber doch sind mir die Freischarenzüge in den
Kanton Luzern in Erinnerung geblieben; man betrachtete sie bei uns
als Raubzüge einer zusammengelaufenen Bande. Auch nur halb war
man mit dem Vorgehen gegen die „kleinen Kantone“ im Sonderbund
einverstanden. So wenig man den Einzug der Jesuiten in den Vorort-
kanton Luzern billigte und so sehr man die Entfernung dieses staats-
gefährlichen Ordens wünschte, so glaubte man doch, dass man ohne
Anwendung von Gewalt zum Ziele hätte kommen sollen. Die gewalt-
tätige Art, wie der Kanton Aargau im Jahre 1841 die Klöster aufhob,
ihr Vermögen als Staatsgut einzog und die Mönche innert kurzer Frist
aus dem Kanton vertrieb, war als rücksichtsloser Akt in der Erinnerung
geblieben.


Zu jener Zeit hatte Pfarrer Zimmermann, Vikar am Fraumünster,
großen Einfluss auf das religiöse Leben gewonnen. Er predigte ein
tatkräftiges Christentum, im Gegensatz zum bisherigen gleichgültigen
Formalismus; seine Kirche war immer gedrängt voll.
Ich war zwanzig Jahre alt, als meine Schwester Elise ins Welsch-
land in die Pension ging. Sie fuhr per Rutsche in Begleitung meiner
Mutter über Yverdon, Chalet à Gobet nach Lausanne und von dort
nach Eaux-Vives zu Pfarrer Duby.
Während ihrer zweijährigen Abwesenheit ereigneten sich viele
Dinge. Da war zuerst die Hochzeit meiner Freundin Amalie Locher
mit Herrn v. Muralt, ein prächtiges Fest in Kloten, das besonders dadurch
sich würdevoll gestaltete, dass die Großeltern der Braut gleichzeitig ihre
diamantene Hochzeit feierten. Mit Leib und Seele war ich bei dem
Fest, freute mich des Glücks meiner Freundin und hatte keinen anderen
Wunsch als ihr glückliches Los.
Meine Freude muss man mir aus den Augen gelesen haben: Andere
wollten auch mich glücklich machen und drei Heiratsanträge waren die
Folge. Das war nun aber gar nicht nach meinem Sinn; ich war gern
zu Haufe und hatte so bestimmte Meinung über das, was sich schickt
und nicht schickt, dass ich an allen etwas auszusetzen fand und dem Herrn
A und dem andern Herrn B und dem dritten Herrn C abwinkte, sobald
ich nur eine Annäherung ahnte. Mein Vater hatte das nicht gerne,
aber ich hatte meinen Kopf und wollte nicht und dabei blieb es.
Es traf sich dann günstig, dass mein Vater wieder nach Wien-
musste und ich ihn begleiten durfte. Per Extrapost ging es über
Konstanz-Memmingen-Mindelheim-Augsburg-München nach Linz, und von
dort per Schiff nach Wien; der Wagen wurde aufs Schiff geladen
Sowohl bei der Abfahrt in Linz, als bei der Ankunft in Wien wurde
geschossen, und dieser Umstand war es, dass Mama, die schon auf der
Reise nach Mailand durch das gelegentliche Schießen erschreckt worden.
war, nicht mit uns kam. In Wien lud Papa die Schweizer Militärs
ein, die zu jener Zeit auf der dortigen Militär-Akademie waren, Voegeli,
Rüscheler, Orelli, Oskar Meiss. Damals standen noch die alten Basteien
und ich hatte eine kindliche Freude an den Grenadieren mit den hohen
Bärenmützen, die an jedem Tor Wache standen.

Papa hatte seine Geschäfte in Neusiedl und während seiner
Abwesenheit nahm sich Herr v. May-Escher meiner an;
er begleitete mich in die Gemäldegalerien, führte mich
zu Dehne, dem berühmten Zuckerbäcker, zeigte mir alle
anderen Herrlichkeiten der Stadt und kaufte mir Kornblumen und Mohn
und ächte Wiener Handschuhe. Bei einer solchen Gelegenheit verlor er-
einmal sein Portemonnaie, und als er es bei der Polizei anmeldete,
frug ihn diese, ob die Dame, die er bei sich habe, auch ganz vertrauens-
würdig sei?
Über den Semmering nach Graz, durch Steiermark und Salzkammer-
gut nach lschl, Gmunden und Salzburg und von dort über Innsbruck
reisten wir heim.
Schon im nächsten Jahr, Sommer 1851, wiederholte Papa die Reise,
und diesmal war Elise bei uns; sie trug ein schwarz-gelbes Kleid, was
den Österreichern schmeichelte. Von Wien machten wir noch einen Abstecher
nach Pest und Ofen, wo wir nach der Türkei hinuntersahen.
Meine Schwester Elise machte es nicht wie ich. Sie war auch
erst aus der Pension heimgekommen und wir hatten sie kaum ein paar-
mal mit dem eleganten jungen Herrn und seinen schönen schwarzen Haaren
necken können — so war sie schon eine Braut. Der Verkündsonntag
fand in Baden statt, bei welchem Anlass Junker Georg Wyss im Letten
den plötzlich am Wechselfieber erkrankten Bräutigam vertrat. Die
Hochzeit wurde am 6. September 1853 in der Kirche in Höngg gefeiert und
das Hochzeitsessen wurde in Baden abgehalten.
Die neuen Beziehungen, welche unsere Familie mit der Familie des
Herrn Landammann Schindler bekam, waren sehr angenehme und bei
der hohen Bildung von Herrn Landammann Schindler auch äußerst
anregend. Allein die Charaktere der beiden Familienvorstände waren
zu verschieden, um ein sehr intimes Verhältnis zwischen dem Kronentor
und dem Kreuzbühl aufkommen zu lassen. Herr Landammann Schindler,
der im Drange seiner eigenen Überzeugung, entgegen der gewalttätigen
Opposition der Katholiken, dem Lande Glarus ein musterhaftes staat-
liches Schulwesen geschaffen hatte, durch welches Glarus andern Kan-
tonen voranleuchtete, Landammann Schindler, der Schöpfer der glar-
nerischen Verfassung von 1836, die auf der Tagsatzung von 1837 von
Ludwig Snell als die vollkommenste der neuern Verfassungen bezeichnet
worden war, war und blieb Magistrat; er war begeistert für die von
ihm als richtig erkannten Grundsätze und glaubte an der eigenen innern
Überzeugung festhalten zu müssen. So war er fremden Meinungen nicht
gerade sehr zugänglich.

Mein Vater dagegen schenkte jeder Meinung Gehör und
seine große Uneigennützigkeit und Herzensgüte ebneten ihm
überall den Boden, auf welchem er zu wirken hatte; er genoss eine
außerordentliche Popularität und jedem schroffen Vorgehen war er abhold.
Eine große Freude für die beiden Familien war im Jahr 1855 die
Geburt des ersten Enkelkindes, des herzigen kleinen Betheli.
In den Jahren 1856 und 1857 machte ich eine Kur in Karlsbad.
Das erste mal verkehrte ich gerne mit den dort anwesenden vornehmen
Damen, was man mir dann zu Hause vorhielt und worauf ich mich so
sehr besserte, dass es im folgenden Jahre hieß, die Damen von Zürich
seien „sehr retirées“. Für die Rückreise von Karlsbad holte uns Papa
jedes Mal ab. Im ersten Jahr besuchten wir die Leipziger Messe, wo Papa
seine Kunden Felix und Schlatter besuchte; der letztere blieb mir als
arger Hagestolz mit großer Gemäldegalerie in Erinnerung. Das zweite
Mal reisten wir über Berlin heim, wo es aber entsetzlich langweilig war.
Im Sommer 1859 waren wir in Pfäfers und Andeer. Es war
sehr heiß und man sprach viel vom lombardischen Krieg; natürlich waren
wir, in Erinnerung der von meinen Eltern 20 Jahre früher unternommenen
Reise zur Krönung des österreichischen Kaisers Ferdinand sehr österreichisch
gesinnt.

Kronentor
Wie immer zogen wir im Winter vom Engenweg ins Kronentor.
Die Eltern führten ein sehr gastfreundliches Haus und oftmals meldete.
der Gewerbsknecht eine Stunde vor Mittag, der Herr Direktor bringe
den oder jenen Herrn zum Essen mit. Viele Leute gingen ein und aus
und wer bekannter war, wurde zum Mittagessen am Sonntag
zugezogen. Dann gab es viele Gänge, guten Wein und gute Zigarren.
Gerne zeigte mein Vater bei solchen Anlässen die verschiedenen
Becher, die ihm geschenkt worden waren. Er besaß auch einen großen
silbernen, teilweise vergoldeten Tafelaufsatz in Form eines bemannten
Kriegsschiffes mit dem Wappen der Herrschaft Kyburg. Der von
Kanonen strotzende Schiffsrumpf konnte als Becher benutzt werden,
auf dem Verdecke tummelten sich kleine Musketiere, während
Matrosen auf den Strickleitern herumkletterten und von den
Mastkörben Ausschau hielten. Der Becher stammt aus dem Besitze des
Landvogtes Beat Holzhalb, der 1681 Landvogt auf Kyburg war. Mein
Vater erhielt ihn aus der Familie Finsler am Rain oder Meyer vom Steg;
er schenkte ihn testamentarisch seinem Neffen, Heinrich Escher im
Wollenhof, der sich in seinen alten Tagen vielfach seiner angenommen
hatte.


Dann und wann wurde auch zu einer „Soirée musicale“ eingeladen;
man musizierte, spielte Whist und wir jungen Damen machten den Tee,
von Kavalieren und Freundinnen umgeben. Hie und da wurde auch
getanzt. Ein Buffet mit Sulzpastetli, kaltem Geflügel, Konfitüren in
reicher Auswahl — der Stolz der Mama — stand zur Verfügung; zuletzt
wurde noch Punsch serviert. Man kam um 7 Uhr und ging um 11 Uhr.
Das Jahr 1860 brachte eine Reise nach London in Begleitung
von Caspar und Elise. Über Köln — Lüttich — Calais — Dover fuhren wir
hin. Zum ersten mal sah ich das Meer, zum ersten mal erfuhr ich,
was es heißt seekrank zu sein. Das Gefühl des Schwankens noch in den
Beinen kam ich nach London, wo wir im London Coffeehouse logierten.
Die gewaltige Stadt amüsierte mich großartig, insbesondere interessierte
mich der damals noch neue Krystall-Palast mit den lebensgroßen Nach-
bildungen urweltlicher Tiere, wie lchthiosaurus, Megalosaurus usw. Das
Wetter war leider nicht immer günstig und ich hatte noch ein bitteres
Erlebnis. Wir beabsichtigten, bei Albert Escher mit Chäppi Hess einen
Besuch zu machen und ich kaufte mir express für diesen Anlass einen
neuen Hut mit weißem Band. Wir saßen in einem Cab wohl versorgt,
da auf einmal spritzt’s auf und alle meine Schönheit wird über und
über mit Rot bedeckt. Wer ihn kennt, diesen klebrigen, schwarzen, imper-
tinenten Londoner Dreck, der nicht wegzuwaschen und nicht wegzuputzen
ist, der begreift meinen damaligen Schreck, den ich bis heute noch nicht
vergessen konnte.
Es ging hierauf mehrere Jahre, bis ich wieder zum Reisen kam;
Magenkrämpfe hielten mich ins Zimmer gefesselt und Prof. Locher
dokterte an mir herum. Aus der langen Zeit ist mir nur eine freudige
Erinnerung geblieben, eine Überraschung, die mir Prof. Locher machte:
ein Korb voll Tschupenhühner mit einem selbstgemachten Gedicht.
Nach und nach kam's dann auch besser und auf Anraten von
Prof. Hesse, der meinen Vater, der sächsischer Konsul war, besuchte,
probierte man im Sommer 1864 eine Kur in Kissingen. Ob es das
dortige Wasser war, oder die guten Bretzeln und Kuchen, die auf langen
Tischen am Kurgarten für den Frühstückstisch ausgelegt waren, oder
die Gesellschaft von Kaiser Alexander von Österreich und Abbé Lisst,
die alle dort waren, oder was immer, ich wurde gesund und eine
Wiederholung der Kur im folgenden Jahre befestigte die guten Resultate
dauernd.

Am 16. September 1866 feierten die Eltern im Engenweg die
goldene Hochzeit. Es war mein glücklichster Tag im Leben. Allseitig
geliebt und geehrt, strömten von allen Seiten Glückwünsche und Geschenke
für meine Eltern herein; sie selbst noch in guter Gesundheit freuten sich
des Tages; zwei Pärchen Enkelkinder stellten den Großvater und die
Großmutter zur Zeit ihrer Verlobung und zur Zeit der silbernen Hochzeit
dar. Acht Tage später feierten die „Jungen“ die goldene Hochzeit im
Schiff in Baden.
Im Winter 1866 begann ich mit dem stark alternden Papa in
den Wollenhof zu gehen, etwa zweimal in der Woche. Er konnte
nicht mehr gut gehen und ich half ihm da und dort, auch beim Ein-
tragen der Bücher; jedes auf einer Siedele saßen wir nebeneinander.
Abends ging er wohl noch auf den Baugarten, das neben dem Kratz-
turm stehende, der Baugartengesellschaft gehörende Gut mit prächtigem
Blick auf den See; er hatte es gerne, wenn ihn einer seiner Enkel bis
dorthin begleitete.
Im folgenden Jahre starb fein Bruder und Associé, was Papa stark
mitnahm; er fühlte seine kraft abnehmen, aber es schien, als ob seine
Herzensgüte nur noch größer und inniger würde. Es war ihm eine
große Freude, seine Enkel um sich zu haben; er erzählte ihnen dann
gerne von den alten Zeiten und was er im Engenweg gemacht und
geändert habe. Seine Vorliebe, die Zigarren mit Feuerstein und Zunder
anzuzünden, ließen aber den guten, lieben Großvater auch den Kindern als
aus einer ältern Zeit stammend erscheinen. Gerne besuchte er von Zeit zu
Zeit die Eyerbrecht, wo er in den 50er Jahren eine Seidenferggerei betrieben
hatte und wo, seit diese eingegangen, seine beiden verheirateten Töchter
während des Sommers haushalteten. Es war bei einem seiner letzten
Besuche dort, als er noch seine Freude äußerte, dass die hohe Tanne
vor der Zinne, die er als kleines Bäumchen gepflanzt, nun schon zum
Dache hinauf reiche. Heute ragt sie weit übers Haus hinaus, sie erfreute
dieses Jahr mit ihrem Schatten die folgende Generation, die nun auch
schon weiße Haare hat ... wenn das der Vater wüsste! So bauet
der Eltern Segen den Kindern Häuser.

Das Jahr 1867 brachte die Cholera-Epidemie nach Zürich. Die
Eltern und ich waren in Baden — wenn auch nicht gern gesehene
Gäste. Dort traf ich wieder einen der Schwerenöter von 1849 und
er ließ es sich nicht nehmen, mir täglich ein Bouquet zu spenden und
mir nach unserer Abreise noch täglich herrliche Blumen von Stänz in
einer großen Schindeldrucke in den Engenweg zu senden. Mägde und
Briefträger trieben ihr Gespött; aber als er dann nach 8 Tagen an
einem trüben Sonntage selbst einrückte, da machte der Regen und meine
Mama der Gärtnerei ein Ende.
Die zunehmende Altersschwäche meines Vaters hatte die Kräfte
der Mutter sehr mitgenommen; ihre Beschwerden vermehrten sich und
sie legte sich am 26. August ins Bett. Von meinen Kindsbeinen bis
zu diesem Tage hatte sie mich immer frisiert. Am 26. September feierte
sie noch meinen Geburtstag mit mir und am 30. September wurde sie
von ihren Bangigkeiten, die sie in der letzten Zeit viel quälten, erlöst.
Wir waren jetzt allein; Papa fuhr täglich in den Wollenhof und
im Winter 1868/69 kam Fräulein Cecile Escher von Berg ins Kronentor.
Zusammen machten wir gerne eine Partie Whist. Papas Kräfte nahmen
sichtlich ab und am 28. September 1870 schloss er sein tatenreiches Leben.

Pauline
Nachdem durch die Teilung der Güter das Kronentor und die
Eyerbrecht an Nanny und das Engenweghaus an Elise gefallen war,
übernahm ich den obern Teil des Engenweg und ließ durch Architekt
Brunner dorthin ein Haus projektieren, wo mein Vater so oft mit
seinen Gästen gestanden, um den Sonnenuntergang zu bewundern. Im
Frühling 1871 war alles so weit fertig, dass mit dem Bau begonnen
werden konnte und ich übertrug die Arbeiten an Baumeister Baur. Ich
wohnte auf der Waid und in Neu-Dettelsau. Von letzterem Ort brachte
ich 1871 Fräulein Wellmer heim und wohnte mit ihr im obern Haus auf
der Waid. Im darauffolgenden Winter war ich im umgebauten
Kronentor, 1872 in Cham ohne den „wüsten Gast“, dann wieder in Neu-
Dettelsau. Im Frühjahr 1873 wurde das Haus fertig. Der Bau hatte wenig
Verdruss gebracht. Die Einweihung des Hauses, das ich „Heimweg“
taufte, fand im Juni 1873 statt. Dekan Zimmermann hielt die Weihrede.
So war ich nun im eigenen Haus und stellte es in den Dient
der Diakonissen vom Zürcher-Krankenasyl und von Dettelsau.


Im Winter war Fräulein Cecile Escher von Berg mein Gast im Kronentor.
Der Gedanke von Pfarrer Spieß, ein Prophetenstübchen im Sinne von
Prophet Elisa Ⅱ Könige 4 einzurichten „Lass uns doch ein kleines
Obergemach mit Wänden machen und ein Bette, Tisch, Stuhl und
Leuchter hineinsetzen, dass wenn der Mann Gottes zu uns kommt, er
sich dahin verfüge“ fiel nicht gut aus; ich musste abwinken.
Meine Schwester Nanny, die ihren Mann auf der Heimreise von
Cannes in eben diesem Jahre verloren, war mein erster Gast. Regel-
mäßig kam sie später zu Tisch. Dann liebte sie zu erzählen von ihren
Gängen ins Krankenasyl, ins Bürgerasyl, ins Seminar Unterstrass und
insbesondere in die Anstalt für Epileptische. Schlicht und streng gegen
sich selbst, hatte sie eine offene Hand für alles, was die Not der Armen
und Kranken zu lindern oder edeln Genuss der Arbeitenden zu fördern
geeignet war. Das Bürgerasyl und die Anstalt für Epileptische sind
bleibende Zeugnisse ihrer segensvollen Wirksamkeit.
Als auch sie am 30. März 1893 nach nur dreitägiger Krankheit
heimging, konzentrierte ich noch mehr wie bisher meine Tätigkeit auf
Hilfeleistungen rechts und links und bekümmerte mich — soweit ich
durfte — für das Wohl meiner Schwester, deren heranwachsende Familie
für mich eine Quelle der Freude und des Interesses wurde. Schmerzlich
berührte mich der Heimgang meines Schwagers im Jahre 1902; er
war mir immer ratlich zur Seite gestanden und sein ernster, auf das
Gute und Wahre gerichtete Sinn war mir sehr sympathisch gewesen.
Fast unbemerkt, Schritt für Schritt ist nun auch für mich das Alter
eingekehrt; mein Geist empfindet zwar noch lebendig und möchte gerne
alles, was an mich herantritt und was um mich herumgeht aufnehmen,
aber die Augen und der Kopf kommen nicht mehr recht nach und
mahnen nur zu oft ans Maßhalten. Da wird’s oft stille im Hause und
trübe Gedanken möchten sich einschleichen; das Abschiednehmen von so
vielem Schönen, so vielem Lieben, so reichen Erinnerungen fällt schwer.
Dann aber tröstet mich Spittas Lied:

Freundlich hast Du mich zu Dir gerufen,
Lieber Herr, doch sind noch viel der Stufen,
Die zum Simmel ich ersteigen muss.
O so reiche Deinem schwachen Knechte.
Aus dem Himmel Deine Gnadenrechte,
Unterstütze, leite meinen Fuß!
Und recht hoffnungsvoll in Deinen blauen
Schönen, fernen Himmel lass mich schauen,
Wenn ich von der Wallfahrt müde bin,
Dass ich hier im tiefen Tal der Schmerzen,
Einen festen Frieden hab im Herzen,
Einen klaren, himmelsfrohen Sinn!


Nachschrift vom Schreiber
Der Schreiber des obigen hat bisher alles getreulich niedergeschrieben,
was ihm die Chronistin diktierte. Nun sie aber Abschied genommen,
will er seine Feder eine kleine Weile weiterlaufen lassen, um noch zwei
eigene Gedanken beizufügen.
Es hat gewiss jeden Leser interessiert zu vernehmen, welch große
Umwälzungen im Laufe der Jahre sich zugetragen haben, und zu sehen
wie aus dem altbackenen Menschen vor 80 Jahren, dem die Postkutsche
etwas Neues war, der moderne Mensch geworden ist, der das Telefon
handhabt und das Luftschiff bewundert. Es wird ihn aber auch gefreut
haben zu sehen, mit welchem Verständnis unsere Chronistin das alles
aufnahm, und es uns heute erzählt, als hätte es nicht anders sein können.
Wenn aber am Schlusse unsere Jubilarin jammert, dass ihre Augen
und ihr Kopf heute nicht mehr recht mitmachen können, so müssen wir sie
daran erinnern, dass sie noch letztes Jahr ein Kirchlein bauen half, zu dem
sie die Pläne beschaffte, dass sie noch lebendiges Interesse nimmt an dem
Kinderspital in ihrer Nähe, dass sie täglich noch Begehren Armer, Gedrückter
oder alter Leute erledigt, dass sie ihr großes Landgut mit seinem Vieh,
seinen Früchten und seinen Blumen täglich noch überwacht, dass sie auch
ihrer Familie eine liebe Schwester und liebe Tante ist, die sich mitfreut,
wenn’s etwas Freudiges gibt und teilnimmt, wenn Sorge einkehrt ...
Und wer sie gesehen hat, wie sie ihre Lebensgeschichte erzählte, wie lebendig
ihr alles noch vor die Augen trat, wie sie noch jeden Namen, jede Jahres-
zahl, jede Begebenheit bis in ihre Kinderjahre zurück mit einer Sicherheit
weiß, die wir in unserer schnelllebigen Zeit bei den Jungen vermissen, der muss
sagen: Wer das alles mit achtzig Jahren noch kann, und wäre auch die
Hand zittrig und das Auge schwach geworden, der besitzt noch viel
Lebenskraft.

Eine Freude war’s aus dieser Urkunde zu schöpfen, und dem Schreiber
Werden die Stunden in der „braunen Stube“, wo die Chronistin erzählte,
stets eine liebe Erinnerung bleiben; eine Freude war’s ihm aber auch,
den sicheren Glauben und das Gottvertrauen zu erkennen, das unserer
Jubilarin die Kraft gibt, ihr Alleinsein und ihre mannigfachen Altersbeschwerden
In Geduld. Ohne viel Klage, zu tragen.
Möge ihr diese Gabe noch manches Jahr erhalten bleiben, zum
Glück für sie selbst. Zur Freude für ihre Nächsten, zur Nachahmung für
Die Jugend. Das ist des Schreibers Wunsch zum 80. Geburtstag der Chronistin.